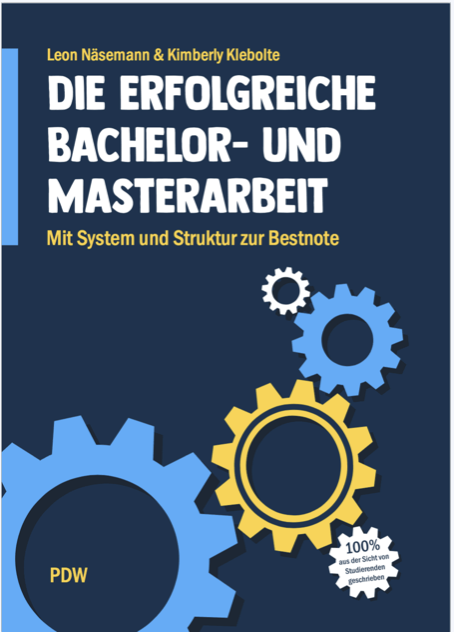Inhaltsverzeichnis
Methodik: Eine kurze Einführung
Bei der Bewertung Deiner Bachelorarbeit wird der Methodenteil von Prüfern besonders unter die Lupe genommen, da Du hier zeigen musst, dass Du einer wissenschaftlichen Fragestellung mit passenden Methoden nachgehen kannst. Wenn Du wissen willst, wie Du aus dem Methodenteil das Beste für Deine eigene Arbeit rausholst, dann ist dieser Beitrag genau richtig für Dich. Wir fokussieren uns hier bewusst auf empirische Methoden aus der qualitativen und quantitativen Forschung, da wir reine Literaturarbeiten bereits in diesem Beitrag thematisiert haben und hierzu auch ein separaten Beitrag zur Quellenarbeit geschrieben haben.
Methoden in unterschiedlichen Fachbereichen
Im Schwerpunkt stehen Methoden, die vor allem in den Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Ingenieurwissenschaften vorkommen. Eine Abschlussarbeit in einem naturwissenschaftlichen Fach – beispielsweise in Chemie, Biologie oder Physik – hat viel häufiger einen praktischen Teil durch die Arbeit im Labor oder durch Feldexperimente. Je nach fachlicher Vertiefung kommen hier wie auch in den Ingenieurwissenschaften eine Vielzahl an Methoden in Frage, sodass eine genaue Betrachtung im Rahmen dieses Artikels leider den Rahmen sprengen würde. Wenn Du Deine Abschlussarbeit in einer dieser Fächer schreibst, kann Dir dieser Beitrag dennoch zahlreiche Tipps und Tricks mit an die Hand geben, denn ganz unabhängig vom Studienfach steht im Methodikteil eines im Vordergrund: Die nachvollziehbare und eindeutige Beschreibung der von Dir durchgeführten Untersuchung. Das kann eine Umfrage für eine Bachelorarbeit in der VWL sein, aber eben auch ein Laborversuch mit Tieren oder Bakterienstämmen im Bereich Biologie.
Im Methodikteil führst Du den Leser Schritt für Schritt durch den Prozess Deiner eigenen Datenanalyse. Er erfährt dabei, was Du gemacht hast und warum genau so. Die folgenden Unterkapitel bieten eine grobe Orientierung, welche Inhalte auf jeden Fall in diesem Kapitel enthalten sein sollten. Die zentralen Inhalte des Methodenteils sind die Forschungsmethode, die Datenquellen und das Analyseverfahren, wie die folgende Tabelle zeigt.
Das vorangegangene Kapitel zur Literaturübersicht schließt in der Regel mit der hergeleiteten Forschungsfrage Deiner Abschlussarbeit ab. Das dritte Kapitel zur Methodik greift genau die- sen Schluss auf und beginnt mit einer Herleitung von möglichen Detailfragen und Forschungshypothesen, die sich aus der zentralen Forschungsfrage ergeben. In manchen Arbeiten werden die Hypothesen und deren Herleitung auch noch in das Ende des Theorieteils untergebracht. Hier fragst Du am besten Deinen Be- treuer einfach direkt, ob er eine bestimmte Struktur präferiert. Wenn es abseits davon keine Vorgaben Deiner Hochschule, Dei- nes Prüfers oder eines möglichen Partnerunternehmen gibt, dann steht Dir nun ein weiten Feld an ganz unterschiedlichen Methoden offen, mit deren Hilfe Du der Forschungsfrage und den Hypothesen in Deiner Arbeit nachgehen kannst. Sich hier zu ent- scheiden ist durchaus komplex, daher begleiten wir Dich in diesem Kapitel in vier einfachen Schritten durch diesen Prozess:
- Schritt 1: Ziel der Arbeit Klären
- Schritt 2: Qualitative vs. Quantitative unterscheiden
- Schritt 3: Übersicht über die Methode gewinnen
- Schritt 4: Methode anwenden
Schritt 1: Ziel der Arbeit definieren
Bevor Du Dir überhaupt einzelne Methoden genauer anschaust oder überlegst, ob Du lieber qualitativ oder quantitativ forschen möchtest, solltest Du Dir klarmachen, was das Ziel Deiner Ab- schlussarbeit sein soll. Damit meinen wir hier nicht das inhaltli- che Forschungsziel, sondern Dein ganz persönliches Ziel. Das Ziel, welches Du mit Deiner Arbeit verfolgst, kann nämlich schon ein guter erster Richtungsweiser sein und indizieren, welche Me- thoden für Dich in Frage kommen könnten und welche eher nicht. Persönliche Ziele einer Abschlussarbeit könnten beispiels- weise sein:
Bestehendes Wissen vertiefen
- Möglicher Ansatz: Wiederverwenden einer empirischen Methode, die bereits in einer Hausarbeit oder ei- nem Praxisprojekt gewählt wurde oder Verfassen ei- ner literaturbasierten Arbeit, zu einem Thema, zu dem bereits in einem anderen Kontext recherchiert wurde
- Beispiel: Du hast bereits im vierten Semester mit einer chemischen Methode gearbeitet oder bist im Rahmen Deines Praktikums schon dabei, Interviews mit Mitarbeitern zu führen – dieses Vorwissen kannst Du nut- zen und im Zuge einer Abschlussarbeit noch einmal mit einem neuen Forschungsthema vertiefen
Neues lernen und sich ausprobieren
- Möglicher Ansatz: Wahl einer bisher unbekannten oder weniger bekannten Methode
- Beispiel: Bisher hast Du vor allem qualitativ geforscht und möchtest jetzt in einem bekannten Fachbereich eine quantitative Abschlussarbeit schreiben
- Hinweis: Bei diesem Vorgehen kannst Du sehr viel Neues lernen, musst aber auch darauf gefasst sein, dass Du langsamer vorankommst, an vielen Stellen noch einmal etwas nachlesen musst, externen Rat brauchst und auch mal etwas schief gehen kann. Eine neue Methode bietet sich daher vor allem bei einem längeren Projekt an, bei dem Du keinen großen Zeit- druck durch eine Abgabefrist hast
- Möglicher Ansatz: Wahl einer gängigen Methode, eines Verfahrens oder Software (R, STATA, SPSS, Fokusgruppeninterviews etc.), die auch im zukünftig an- gestrebten Arbeitskontext relevant ist
- Beispiel 1: Durchführung einer quantitativen Datenauswertung von Sekundärdaten, da Du später einen Arbeitsplatz im Controlling oder der Unternehmenssteuerung anstrebst, wo Du voraussichtlich viel mit großen und komplexen Datensätzen arbeiten wirst
- Beispiel 2: Fundierte Literaturanalyse innerhalb eines Literature Reviews zu einem bestimmten Themenbereich, da Du in diesem Teilbereich ein Masterstudium anstrebst und so schon eine solide Wissensgrundlage mit in den nächsten akademischen Schritt bringst.
Grundsätzlich gibt es zwei zentrale Richtungen, die Du in der empirischen Forschung einschlagen kannst. Zum einen können durch empirische Abschlussarbeiten Hypothesen geprüft werden, wobei Du aus der bestehenden Literatur und aus bestehenden Modellen und Theorien Hypothesen ableitest und diese dann testest (Hypothesentestung). Auf der anderen Seite kannst Du je- doch auch empirisch vorgehen, um von der Empirie auf die Theorie zu schließen, also um Hypothesen zu bilden (Hypothesenentwicklung). Du hast in diesem Fall zuerst die Ergebnisse Deiner Forschung und versuchst dann aufbauend darauf neue Modelle oder Theorien zu formulieren.
Schritt 2: Qualitativ vs. Quantitativ
Empirische Forschung kann qualitativ oder quantitativ sein. Im zweiten Schritt geht es darum, herauszufinden, welche Art der Forschung für Deine Forschungsfrage am besten geeignet ist. Bei- de empirischen Forschungsansätze bringen ihre eigenen Vor- und Nachteile mit und sind je nach Forschungsfrage und Thema einer Arbeit besser oder schlechter geeignet. Um Dir einen ersten Über- blick zu verschaffen, haben wir die zentralen Punkte beider Ausrichtungen kurz zusammengestellt.
Kennzeichen qualitativer Forschung:
Häufig explorative Fragestellungen, die sich mit neuen Themenbereichen beschäftigen, zu denen es noch keine Grundlagenforschung oder breit akzeptierte Modelle und Theorien gibt
Ziel ist es, neue Bereiche kennenlernen und darauf aufbauend neue Theorien entwickeln, ein Themengebiet neu zu verstehen oder neue Sichtweisen von be- stimmten Personen(-gruppen) zu bekommen
Im Vordergrund steht die Analyse eines Phänomens
Induktiv, d.h. Hypothesen werden durch statistische Verfahren überprüft
Die Forschung ist nicht standardisiert und ergebnisoffen, das heißt es gibt keine Erwartung an die Ergebnisse und keine fundierte Vorhersage
Die Auswertung beruht häufig auf der Interpretation des Forschers bzw. einer Forschergruppe
Im Fokus stehen Einzelfallbetrachtung oder die Betrachtung einer relativ kleinen Gruppe.
Im Kern geht es darum, mit qualitativer Forschung ein relativ breites Abbild zu erhalten, ein Thema im Ursprung zu verstehen und neue Themenfelder und Zusammenhänge zu entdecken. Qualitative Forschung ist gut geeignet für Deine Abschlussarbeit, wenn:
es in Deinem Themenbereich noch keine breite Masse an veröffentlichten Ergebnissen oder Wissen gibt
Du ein Thema breitgefächert entdecken möchtest und Dich für die Perspektiven, Meinungen und Blickwinkel einzelner Personen interessierst
Du komplexe Zusammenhänge erkennen möchtest, die sich möglicherweise nicht einfach in Zahlen und Daten abbilden lassen.
Du möglichst individuelle und aussagekräftige Daten sammeln möchtest
Nachteile qualitativer Forschung:
Du bist auf Teilnehmer angewiesen, die sich länger Zeitnehmen (z.B. im Rahmen von Interviews)
Relevante und spannende Gesprächspartner sind schwierig zu finden (z.B. für Experteninterviews)
Du hast einen hohen Koordinationsaufwand (z.B. für Gruppendiskussionen)
Du bist geografisch – zumindest bei persönlichen Gesprächen – beschränkt, wenn Du nicht weit reisen möchtest/kannst
Die Ergebnisse bilden die Realität nur eingeschränkt ab und es lässt sich i.d.R. keine Repräsentativität herstellen
Weiter unten wirst Du die drei Gütekriterien der quantitativen Forschung kennenlernen, die sich in der akademischen Fachwelt als Standard etabliert haben. Im Bereich der qualitativen Forschung gibt es derzeit noch keine allgemein-gültigen Gütekriterien, jedoch drei Dinge, die Du berücksichtigen solltest, damit Du eine hochwertige Arbeit ablieferst. Diese drei Kriterien sind:
Unsere Buchempfehlung für Deine Abschlussarbeit!
Wie finde ich ein passendes Thema für meine Abschlussarbeit und überzeuge meinen Betreuer davon? Was bedeutet „wissenschaftliches Arbeiten“ konkret und welche Elemente gehören in den Diskussionsteil meiner Arbeit? Unser Buch bietet umfassende Antworten auf all diese Fragen und begleitet dich Schritt für Schritt durch die Erstellung deiner Bachelor- oder Masterarbeit.
Kennzeichen quantitativer Forschung:
Im Vordergrund steht das Hypothesentesten, also das Testen von bereits existenten Hypothesen, Theorien und Ideen der Wirklichkeit
Es geht um die Abbildung der Realität durch statistische Verfahren
deduktiv, d.h. neue Hypothesen werden mit den Ergebnissen aufgestellt
Es wird mit standardisierten Messungen und bestehenden Messverfahren gearbeitet
Es erfolgt eine statistische Auswertung nach mathematischen Modellen
Ziel ist es, mit einer geeigneten Stichprobe Repräsentativität zu schaffen und Aussagen und Schlussfolgerungen für die Gesamtpopulation treffen zu können.
Quantitative Forschung ist gut geeignet für Deine Abschlussarbeit, wenn:
es bereits bestehende Theorien und Modelle gibt, die Du in der Wirklichkeit testen möchtest
es in Deinem Themenfeld viele (quantifizierbare) Daten gibt bzw. Du möglichst viele Daten erheben möchtest
Du gerne mit Daten und statistischen Verfahren arbeitest
Du Aussagen über die Allgemeinheit treffen möchtest (d.h. über eine Gruppe von Leuten, die über Deine Probanden hinausgeht).
Nachteile quantitativer Forschung:
Du brauchst eine relativ große Anzahl an Teilnehmern bei
Umfragen, um repräsentative Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können
Du brauchst bei Sekundäranalysen Zugriff auf große und vollständige Datenbanken (z.B. von der EU)
Du brauchst solide Kenntnisse statistischer Methoden und musst wissen, wie Du große Datenmengen mit Statistikprogrammen analysieren kannst
Du brauchst (v.a. in den Naturwissenschaften) einen Zugang zu relevanten Stoffen und Materialien sowie zu Untersuchungsgeräten im Labor
Ganz unabhängig von der konkreten Methode gibt es in der quantitativen Forschung drei zentrale Gütekriterien, die erfüllt werden müssen, damit es sich um eine wissenschaftlich hochwertige Arbeit handelt:
Mit der Übersicht zu qualitativen und quantitativen Methoden möchten wir Dir zeigen, dass es immer einen Zusammenhang zwischen Fragestellung und Methodik gibt, das heißt es gibt Fragestellungen, die sich nur mit einer bestimmten Methode beantworten lassen können und andersherum Methoden, die sich nur für bestimmte Arten von Fragen eignen. Möchtest Du einen Themenbereich neu erkunden, in dem es noch nicht so viel Forschung und feste Theorien gibt und in dem Du auch noch kein großes Hintergrundwissen mitbringst, dann eignen sich vor allem qualitative Methoden. Möchtest Du hingegen eine Frage beantworten, die ein breites Theoriefundament hat und zu der es bereits einige Ansätze in der Literatur gibt, dann eignen sich vor allem quantitative Methoden. Im Methodenteil geht es darum, zu beschreiben, wie Du methodisch vorgegangen bist, aber auch, warum Du Dich für eine Methode entschieden hast und in welchem Rahmen sie Deine Forschungsfrage beantworten kann. Sei daher bei der Auswahl der Methoden kritisch, indem Du Dich fragst, ob die ausgewählte oder präferierte Methode wirklich eine zufriedenstellende Antwort auf Deine Forschungsfrage liefern kann.
Schritt 3: Übersicht über die Methoden gewinnen
Nachdem Du Dich ganz grundlegend für einen qualitativen oder einen quantitativen Forschungsschwerpunkt entschieden hast, möchten wir Dir nun aus beiden Bereichen jeweils drei Standard- methoden vorstellen, die Du sicherlich bereits aus den Studien der Literaturrecherche kennst. Noch einmal zur Wiederholung:
Bei qualitativer Forschung geht es vor allem darum, neue Theorien aufzustellen, während es bei quantitativer Forschung eher dar- um geht, bestehende und bekannte Theorien zu testen.
Qualitative Methoden
Bei qualitativen Methoden stehen vor allem Meinungen, individuelle Perspektiven und Motive im Vordergrund, weniger reine Zahlen und standardisierte Daten. Daher werden qualitative Stu- dien in der Regel auch durch Interpretation des Forschers aus- gewertet und nicht mit Hilfe von statistischen Programmen oder mathematischen Formeln. Du als Forscher bist hier auch im Zuge einer Abschlussarbeit bei allen Methoden zentraler Bestandteil der Datenerhebung, da Du bei Experteninterviews oder Gruppendiskussionen und Fokusgruppen immer zentraler Gesprächspart- ner bist oder bei der Analyse von Dokumenten und Schrift- stücken oder einer Beobachtung derjenige bist, der das Gelesene und Gesehene einordnen kann und so einen Kontext gibt. Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Methoden.
Liste von Hochschulen die zum Thema Methodik veröffentlichen
- Technische Universität München (TUM) – https://www.tum.de/
- Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) – https://www.uni-muenchen.de/
- Freie Universität Berlin (FU Berlin) – https://www.fu-berlin.de/
- Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) – https://www.hu-berlin.de/
- Universität Heidelberg – https://www.uni-heidelberg.de/
- Universität Hamburg – https://www.uni-hamburg.de/
- Universität Köln – https://www.uni-koeln.de/
- Technische Universität Berlin (TU Berlin) – https://www.tu-berlin.de/